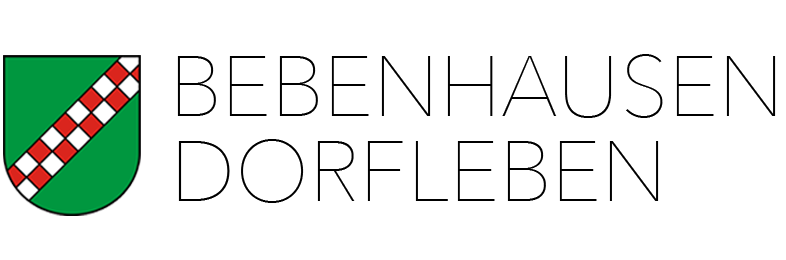Unsere Geschichte
Den Beginn der Geschichte Bebenhausens kann man zu verschiedenen Zeitpunkten sehen. So gab es frühe Siedlungen, eine KLostergründung, die Ansiedlung einer evangelischen Klosterschule und die Nutzung der Räumlichkeiten durch das württembergische Königshaus. Die Bildung einer rechtlich selbstständigen, bürgerlichen Gemeinde erfolgte erst Kraft “höchster Erschließung”des königlichen Kammeralamtes am 23. März 1823. Die hier erzählte Geschichte setzt bei diesem Datum ein.
-
Geschichte Bebenhausen
Am 18. März 1823 ordnete König Wilhelm I. von Württemberg die kommunale Selbstständigkeit des Klosterdorfes an. Die dort noch lebenden “Offizianten”, wie die ehemaligen Bediensteten der Klosterschule hießen, konnten die Gebäude, in denen sie wohnten, kaufen. 17 Familien wurden die ersten Bürger und Bürgerinnen des Dorfs Bebenhausen. Kirchlich blieb der Ort nach Lustnau eingepfarrt.
Erster Schultheiß wurde Klosterküfer Christian Eberhard Erbe. Die neue Gemeinde hatte jedoch wirtschaftliche Schwierigkeiten, da große Teile der Markung in Staatsbesitz verblieben und dadurch eine Vergrößerung der landwirtschaftlichen Betriebe und die Ansiedlung neuer Bürger erschwert wurde.
1841 wurden die ehemaligen Klosterteiche für den Bau einer neuen Staatsstraße (die heutige L1208) trockengelegt. Von dem regen Durchgangsverkehr profitierte das bisher abseits gelegene Klosterdorf, das Gasthaus zum Waldhorn wurde an der neuen Straße gebaut.
Um 1850 befand sich das ehemalige Kloster in einem Zustand der Verwahrlosung, woraufhin der Staat ab 1864 Teile des Klosterbezirks zurückkaufte und das Kloster umfassend restaurierte.
1887 wurde im Königreich Württemberg bürgerliche und kirchliche Gemeinden getrennt. Die Evangelische Kirchengemeinde Bebenhausen entstand.
1897 kaufte König Wilhelm der II., Nachfolger König Karls, die Klostermühle mit den dazugehörenden Gebäuden. In Verbindung mit einer Wasserleitung zum Schloss, ließ er dort 1899 eine Turbinenanlage zur Erzeugung elektrischen Stroms einbauen.
1914 erhielt Bebenhausen erstmals ein eigenes Schulhaus als Stiftung des letzten württembergischen Königs. Bis dahin wurde der Unterricht im ehemaligen Kloster abgehalten. Die Schule wurde 1970 aufgelöst.
im Jahr 1915 beschloss der Gemeinderat Bebenhausen unterhalb der Ziegelbrücke ein Waagehäusle zu bauen, damit die landwirtschaftlichen Produkte aus Waldhausen dort gewogen werden konnten.
Im Dezember 1925 wurde das neu erbaute Rathaus von Bebenhausen eingeweiht. Damit besaß der Ort erstmals ein eigenes Verwaltungsgebäude.
Am 19. April 1945 besetzten Truppenteile der 5. französischen Panzerdivision Bebenhausen.
1948 wurde der Gemeinde Bebenhausen das Gemeindewappen verliehen. Es zeigt in Grün einen von Rot und Silber doppelreihig geschachten Schräglinksbalken, den sogenannten Zisterzienserbalken.
Zum 1. November 1974 wurde Bebenhausen nach 150 Jahren Selbstständigkeit als Teilort der Universitätsstadt Tübingen angegliedert
Durch Ausweisung als erste denkmalgeschütze Gesamtanlage des Landes Anfang 1975 ist das Dorfbild Bebenhausens nach dem neuen Denkmalschutzgesetz unter Ensembleschutz gestellt. 1994 wurde vom Gemeinderat für Bebenhausen eine Ortsbildsatzung beschlossen.
Seit 1984 gibt es einen Kindergarten, der mit viel Eigenbeiträgen aus dem Dorf erbaut worden ist.
Schon in 1980er Jahren wurde immer wieder über zwei Verkehrsthemen gesprochen. Eines war die Parksituation, das andere der Rittweg, also die Verbindung nach Waldhäuser-Ost.
Der Rittweg wird seit 1984 im Winter bei Glatteis auf der Straße geschlossen, seit 1992 gibt es darüberhinaus an Sonn- und Feiertagen ein Durchfahrtsverbot. Das wird auch mittels von Schranken, die ehrenamtlich geschlossen werden, durchgesetzt.Das 175-jährige Jubiläum des Dorfs wurde 1998 mit einer Festwoche gefeiert.
Nach längeren Planungen konnte im Jahr 2002 die Fertigstellung des großen Parkplatzes vor dem Dorf gefeiert werden.
Im Jahr 2023 wurde der 200. Geburtstag des Dorf in verschiedenen Veranstaltungen gefeiert.
Im Dezember 2025 wird das Rathaus 100 Jahre alt und das Waagehäusle erhält eine neue Funktion: nach einem Umbau durch engagierte Bürger bietet es Platz für einen Verkaufsautomaten mit regionalen Produkten und für einen Bücherschrank für die Dorfbewohner.
-
-
-
-
Hans Haug, Im Schatten des Klosters.Das Dorf Bebenhausen, Silberburgverlag 2013.
Dies Buch ist nicht mehr im Handel erhältlich. Man kann versuchen es über das Zentralverzeichnis antiquarischer Bücher (zvab) zu bekommen.Hans Haug, Bebenhausen, Vom Beginn des Nationalsozialismus bis zur Eingemeindung, Privatdruck 2022.
Ausgezeichnet mit dem Zweiten Landespreis für Heimatforschung des Landes Baden-Württemberg 2024